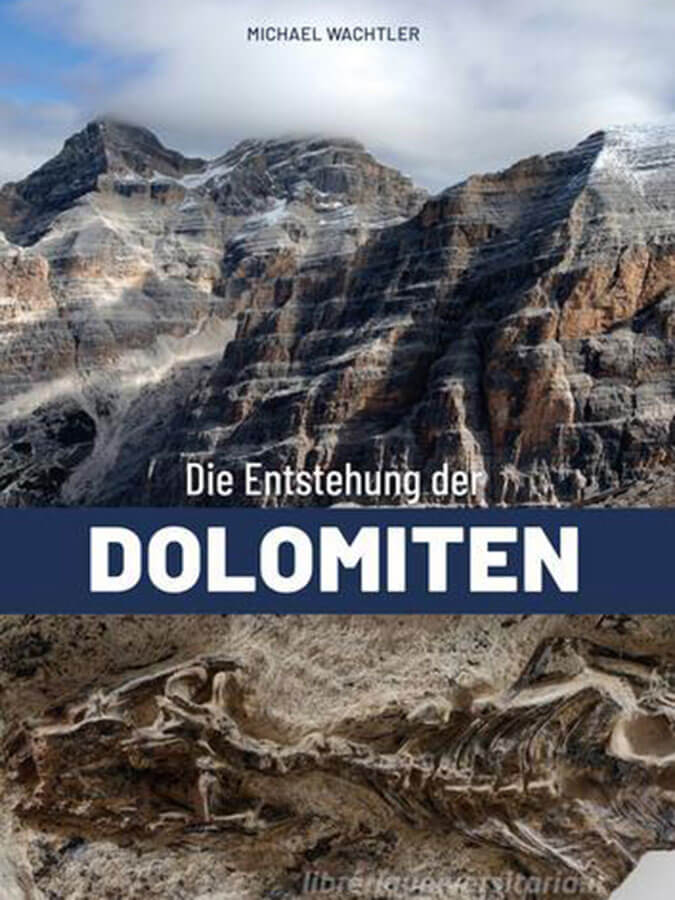
Michael Wachtler
Verlag DoloMythos - Innichen
www.dolomythos.com
Euro 34,90
Dominierten die europäisch-amerikanischen Wälder im Karbon die Bärlappe, Schachtelhalme und Farne, erfolgten im Perm deren Niedergang und ein Ausbreiten der Nacktsamer wie der Nadelbäume, Ginkgos oder Palmfarne. Auf der Südhalbkugel, dem ehemaligen Gondwana-Kontinent, welcher sich auf das heutige Australien, das südliche Afrika, Südamerika sowie die Antarktis aufteilte, entwickelte sich zwischen Karbon und Perm in einem gemäßigten bis kühlen Klima die sogenannte Glossopteris-Flora, charakterisiert durch Samenanlagen und Pollenorganen, die zungenartigen Blättern entsprangen. Eine dritte, noch spektakulärere Vegetation bildete sich auf einem isolierten Kontinent heraus, der vom österreichischen Forscher Eduard Suess den Namen Angara-Land erhielt und Teile Russlands, des Urals und Sibiriens umfasste. Abgeschottet über viele Millionen Jahre, herrschte dort eine eigenartige Pflanzenwelt, welche zum größten Teil als Vorfahren der Angiospermen eingeordnet werden kann, während die Gymnospermen im Hintergrund blieben. Viele der heute bekannten Blütenpflanzen müssen dort ihren Ursprung genommen haben.
So finden sich ab dem Unterperm schon Vorläufer der Steinfrüchte wie der heutigen Kirschen, Pflaumen oder Aprikosen, aber genauso Eichen-Urahnen, Ahorne, Eschen und Ulmen mit ihren leicht variierenden Flügelsamen, ja sogar die Vorläufer niedrig wachsender Blumen und Gräser. Sie erinnern in so vielen Belangen an die heutigen Blütenpflanzen-Nachfahren, dass sie oft kaum von ihnen unterschieden werden können, so als hätte sich in nahezu 300 Millionen Jahren nicht allzu viel verändert. Damit gerät sogar die bisher allgemein anerkannte Magnolien-Theorie ins Wanken, nach der sich aus primitiven Magnolien alle anderen Angiospermen ableiten lassen.
Wahrscheinlich muss die gesamte Evolution der Blütenpflanzen aufgrund neuer Funde aus dem Ural vollkommen umgedacht werden. War einmal die prägendste Eigenschaft aller Blütenpflanzen – die Blüte – entwickelt, lassen sich alle anderen etwa 370.000 Angiospermen relativ leicht ableiten. Und der Weg dahin war genauso genial wie jener der im Perm noch hauptsächlich in Europa und Amerika aufgefundenen Koniferen oder Cycadeen. Denn während sich auf der sonstigen Nordhalbkugel im Perm kaum Insekten finden lassen, fiel der ehemalige Angara-Kontinent durch eine solche Vielzahl an Grillen, Fliegen, Bienenvorläufern, Spinnen, Libellen und Schaben – vielfach unter ihnen potenzielle Pflanzenbestäuber – auf, dass eine Symbiose naheliegend ist.
Warum aber konnten sich diese Blütenpflanzenvorfahren in der Folge, besonders in der Trias, als sich alle Kontinente einschließlich Angara für Millionen Jahre vereint hatten, nicht rasant weltweit ausbreiten? Eigentlich kann dies nur damit erklärt werden, dass die gewaltigen sibirischen Vulkanausbrüche als bisher meistgenannte Ursache dieser „Mutter aller Katastrophen“ dem frühen Siegeszug der Angiospermen ein Ende setzten. Damit müssen vor allem die Blütenpflanzen als durch die Perm-Trias-Katastrophe in Mitleidenschaft gezogene Lebensgemeinschaft genannt werden. Weltweit erholen konnten sich die Blütenpflanzen dann erst richtig ab Beginn der frühen Kreidezeit, wobei es ihnen wohl aufgrund des Aufkommens der Vögel als exzellente Samenverbreiter tatsächlich gelang, sich weltweit rasant auszubreiten.